|
Klaviaturen
Gestalt und Bespielbarkeit
Teil 1
von
Herbert Henck
Teil 1
Teil 2
Kapitel 1
Die Klaviatur als chiffrierte Chromatik
Die folgenden Überlegungen nehmen ihren Ausgang bei der Konstruktion der sogenannten variablen Akkordleiste, einem mechanischen Hilfsmittel, das die Möglichkeit bietet, auf
einer Klaviertastatur alle erdenklichen und vorstellbaren Akkorde anzuschlagen, wobei Rücksichten auf manuelle Spielbarkeit oder die geläufige Aufteilung in Unter- und Obertasten entfallen.
Dieses Gerät erfand ich 1994, erst in Gedanken, dann in Skizzen auf dem Papier, und ein Text darüber mit dem Titel Entwurf einer variablen Akkordleiste. Konstruktion – Funktionen – Anwendung liegt im Manuskript vor; eine Kurzfassung dieser Beschreibung ist in meinem Buch Klaviercluster eingeschoben. [1] Die praktische und eigentlich musikalische Erprobung der dort mitgeteilten Ideen und Veränderungsvorschläge steht noch aus, und vieles ist spekulativ, doch scheint es mir, als ob sich zunächst dem Improvisierenden neue Erfahrungen des Klavierspiels erschließen können. Die Überlegungen zielen dabei nicht auf die Ablösung des vorhandenen Tastensystems durch ein anderes, sondern stets geht es nur um eine Ergänzung und wechselseitige Bereicherung von Altbekanntem und Neuem.
Die Universalleiste hebt – nur so viel sei an dieser Stelle erwähnt – im Bereich ihrer Regulierschrauben für die Anschlagsstifte sowie der an ihnen befindlichen Skala
die mechanisch-optische Gliederung der Klaviatur in Ober- und Untertasten auf und bietet den Spielern die chromatische Anordnung der Saiten ungebrochen. Diese Dechiffrierung lockert die starke
geschichtliche Prägung der Tastenanlage und fördert eine vergleichsweise neutral empfundene, physikalisch-objektive, ja wissenschaftliche Betrachtung der instrumental verfügbaren Tonhöhen. Zugleich wird
ein Denken sowohl in systematische, lineare wie nur statistisch fassbare musikalische Zusammenhänge geöffnet, die sich sowohl kompositorisch wie improvisatorisch verwirklichen lassen – Zusammenhänge, die
ungleich weniger belastet sind von dem überlieferten, pianistisch verinnerlichten Tastengebrauch und somit dem Streben nach künstlerischer Autonomie entgegenkommen. Das vertraute Bild der Klaviatur wird dabei durch
das bereits Immanente ergänzt, sichtbar und wieder bewusst gemacht.
Der chromatische Aufbau des Saitenfeldes der Klavierinstrumente ist zum einen eine physikalisch ausgerichtete Ordnung, und exakte Berechnungen und Bemessungen von Saitenlängen,
-stärken, -spannungen, Material, Elastizität usw. gehen ihm voraus und stehen völlig im Vordergrund bei der sich immer von dem Gehör zu rechfertigenden Konstruktion des Instrumentes. Die vom Bass sich zum Diskant
hin verkürzenden und zugleich verjüngenden Saiten beeinflussen beim Flügel maßgeblich die äußere harfenartig geschwungene Gestalt, und der sich aus dieser Einrichtung ergebenden Kurve passen sich nach unten die
Formen von Gussplatte, Resonanzboden und Rasten, seitlich die der Zargen und nach oben die des Deckels an.
Zum anderen ist die Chromatik mit einer gleichschwebenden Temperatur ein enharmonischer Kompromiss, der in einem bestimmten historischen Abschnitt der Entwicklung der
Klavierinstrumente getroffen wurde, um eine maximale funktionsharmonische Beweglichkeit zwischen allen Tonarten und eine optimale Modulationsfähigkeit zu erreichen. Die Tonhöhen sollten dabei grundsätzlich als
gleich große Stufen mit gleich großen Spannungen empfunden werden können, wobei zugleich die Schwebungen, die unvermeidlich auftraten, auf ein Mindestmaß der Hörbarkeit zu beschränken waren.
Diese Ordnung ist plausibel, übersichtlich, lässt sich hinreichend leicht abstrahieren, in wesentlichen Punkten zahlenmäßig erfassen und graphisch abbilden. Gleichwohl ist nicht zu
übersehen, dass sie nur eine von unendlich vielen Möglichkeiten ist, die Oktave oder den zur Verfügung stehenden Ambitus zwischen einem höchstem und einem tiefstem Ton in Intervalle zu unterteilen, und
dass mit der Wahl einer chromatischen und gleichschwebenden Ordnung eine ebenso konsequente Entscheidung getroffen wurde wie mit der Wahl der Diatonik als Grundlage der Tastatur. Die diatonische
Tonfolge lässt sich im übrigen nicht weniger stimmig als die Chromatik aus akustisch-physikalischen Voraussetzungen entwickeln, und historisch gesehen erscheint die Diatonik nicht etwa als Auswahl bestimmter Töne
aus der umfassenden Chromatik, sondern umgekehrt die Chromatik als Ableitung und Ausbau der Diatonik. [2]
Die Klaviatur in ihrer heutigen Form ist bekanntlich eine optisch überwiegend weiße, periodisch gemusterte längliche und nach unten abgewinkelte Fläche, die von den Zweier- und
Dreiergruppen der schwarzen Obertasten farblich und räumlich gegliedert wird. Abgesehen von lediglich dem geweckten Auge wahrnehmbaren Breitenunterschieden [3] ist die Folge der Untertasten ein ebenmäßiger Puls, der die Grundlage des Spielfeldes bildet. Die Gruppen der Obertasten sind entsprechend ein hiervon sich räumlich abhebender intermittierender Puls, ein Puls, der sich auf höherer Ebene durch Wiederholung von Fünfergruppen auszeichnet, die ihrerseits alternierend aus Gruppen von 2 plus 3 Obertasten bestehen. Beide Tastengattungen besitzen auf Grund ihrer eigenen Farben, Formen und Räumlichkeit ein so hohes Maß an optischer Idiomatik, dass der Aspekt ihrer komplementären Chromatik verdeckt und chiffriert wirkt.
Betrachtet man beide Gattungen in ihrer Beziehung zueinander, so wird zunächst erkennbar, dass die Linearität der Obertasten stets durch das Auftreten von je zwei Untertastenpaaren in
jeder Oktave (die Halbtonschritte e–f und h–c) aussetzt, dass ansonsten aber ein regelmäßiger Wechsel der Tastengattungen stattfindet. Dieser Wechsel ist freilich kaschiert oder besser
nivelliert durch den Winkelschnitt in den Untertasten, der sie, ungeachtet ihrer Unterbrechung durch die Halbtöne der Obertasten, an der Vorderkante wieder zu gemeinsamem räumlichem Abschluss zusammenführt [4]
Zwei Symmetrien in jeder Oktave sind das Resultat des Ineinandergreifens der Tastengattungen – Symmetrien, die von den Klavierbauern nicht willentlich und funktional in
die Klaviatur einbezogen worden waren, sondern die sich aus den diatonischen Vorgaben ebenso unbeabsichtigt, ja zwangsläufig ergaben wie etwa die Möglichkeit, die beiden Tastengattungen separat durch Glissandi oder
Cluster zum Klingen zu bringen. Denn nimmt man ein beliebiges d oder gis als Startpunkt und Spiegelachse (freilich dürfen diese Töne nicht ganz am Ende der Klaviatur liegen), trifft ein gleichzeitiges tastenweises Auf- und Absteigen (Pendeln) stets auf dieselbe Tastengattung (Obertasten hier farblich von den Untertasten unterschieden):
[
|
|
|
|
|
|
g
|
|
|
|
|
|
|
|
cis
|
|
|
|
|
|
fis
|
|
|
|
|
|
|
|
c
|
|
|
|
|
|
f
|
|
|
|
|
|
|
|
h
|
|
|
|
|
|
e
|
|
|
|
|
|
|
|
ais
|
|
|
|
|
|
dis
|
|
|
|
|
|
|
|
a
|
|
|
|
|
|
d
|
|
|
|
|
usw.
|
|
bzw.
|
gis
|
|
|
|
|
usw.
|
|
|
cis
|
|
|
|
|
|
|
|
g
|
|
|
|
|
|
|
|
c
|
|
|
|
|
|
|
|
fis
|
|
|
|
|
|
|
|
h
|
|
|
|
|
|
|
|
f
|
|
|
|
|
|
|
|
ais
|
|
|
|
|
|
|
|
e
|
|
|
|
|
|
|
|
a
|
|
|
|
|
|
|
|
dis
|
|
Erst im Juni 2005 entdeckte ich in einem großen Aufsatz von Hans Joachim Moser, dass der deutsch-amerikanische Musiktheoretiker Bernhard Ziehn (1845–1912) eben dieses System verwendet hatte,
„um die beiden Hände völlig symmetrisch zu schulen und zu entwickeln, indem die Übungen für die eine Hand so eingerichtet sind, daß sie sich zu strengster
Spiegelbildlichkeit umkehren lassen, oder bei Zweihändigkeit die Schwierigkeiten der einen Hand in der andern genau wiederkehren lassen.“ [4a]
Die zwei Abbildungen, die sich enger auf die Noten beziehen und die Entsprechung zur symmetrischen Anordnung der Finger in beiden nebeneinander liegenden Händen des
Klavierspielers besser zeigen, seien hier aus Mosers Aufsatz übernommen:
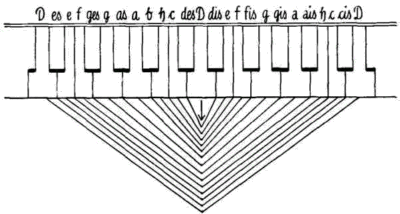 |
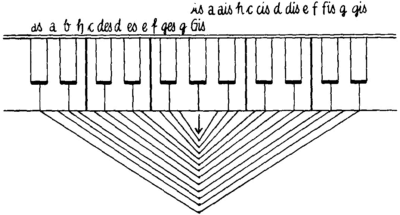 |
Was vielleicht aber noch bemerkenswerter ist als diese Nutzung der Klaviaturgestalt zu einer ebenmäßigen Ausbildung der Hände, ist der Umstand, dass Bernhard Ziehn
dieses System der Symmetrien „später zu einer ganzen Kompositionstechnik weiterentwickelt hat“ und zu einer Reihe von harmonischen und satztechnischen
Überlegungen kam, die weit in die Moderne weisen. [4b] Inzwischen ist auch Ziehns Buch Canonical Studies. A New Technic in Composition im Internet als download
der Erstausgabe von 1912 erhältlich, und das Interesse an Ziehns Theorien scheint allmählich zu wachsen. [4c] Gleichwohl möchte ich nicht versäumen, auf Chicago
Tribute (1990–1991) des amerikanischen Komponisten Kyle Gann (geb. 1955) aufmerksam zu machen, der sich in diesem Werk für acht Instrumente ausdrücklich auf
eine harmonische Spirale bezieht, wie sie von Ziehn beschrieben wurde. [4d]
Da das Thema der Symmetrien nun einmal angesprochen ist und in der jüngeren Vergangenheit bereits eine so bemerkenswerte Behandlung erfuhr, sei ergänzend
erwähnt, dass sich noch weitere Symmetrien in der Tastenanlage finden lassen, auch wenn die beiden genannten Arten die einzigen sind, die sich in beiderlei Richtung
beliebig erweitern lassen, ohne die Symmetrie aufzugeben. Gleichviel seien nicht jene kleineren Symmetrien übersehen, die nur teilweise zusammenfallen mit den schon
genannten Skalen. Entscheidend ist, ob man eine einzelne Taste oder ein Tastenpaar als Ausgangspunkt der Symmetrie wählt.
Statt von einem einzelnen, als Spiegelachse dienenden Ton (d oder gis) kann man ebenso gut von zwei nebeneinander liegenden Tönen ausgehen, die zu verschiedenen Tastengattungen gehören. Als virtuelle Achse dient dann ein Paar
aus Unter- und Obertasten (f-fis bzw. b-h [Obertasten unterstrichen]):
Achse f-fis: | e-g | es-gis | d-a | des-b | c-h | h-c | b-cis | a-d | as-dis | g-e |
fis-f | [Achse:] f-fis |
Dann oktaviert weiter wie zu Anfang
Achse b-h: | a-c | as-cis | g-d | ges-dis | f-e | e-f | es-fis | d-g | des-gis | c-a |
h-b | [Achse:] b-h |
Dann oktaviert weiter wie zu Anfang
Wie man sieht, wiederholen sich die Achsentöne zunächst in ihrer Umkehrung, dann in ihrer oktavversetzten Originalform, bevor die chromatische Fortschreitung nach oben
und unten die Töne des Anfangs wiederholt.
Noch andere Symmetrien, die zu kürzeren symmetrischen Skalen führen, lassen sich finden oder auch Skalen, die (anstatt in Spiegelbewegung auseinander streben) sich
streng parallel bewegen, doch wäre dies kein guter Ort, sich über all dieses zu weitläufig auszubreiten, und somit mag das Aufzeigen des Ansatzes genügen.
Konzentriert man sich einmal auf das Bild der traditionellen Tastatur und lässt sich nicht von deren scheinbar weißer Grundlage ablenken, werden alle genannten Symmetrien
wie auch noch andere schnell sichtbar, denn es sind keine akustischen, sondern in allen Fällen optische. Die Frage, wie es zu diesen Symmetrien und einer doppelten
Bestimmung durch die Proportion 5 : 7 kommt, habe ich in einem Aufsatz mit dem Titel Symmetrie der Tasten behandelt.
Damit zurück zur Tastenanlage. Insgesamt zwingt die Klaviatur die Chromatik räumlich
und tastenfarblich in eine hoquetusartig rhythmisierte Gestalt, die sich grifftechnisch ganz aus der Geschichte begründet, akustisch aber heute fast keine Entsprechung mehr hat.
Dies hat seine Ursache darin, dass der ursprüngliche Ansatz, der die Belegung der Tasten mit Tönen leitete, ein diatonischer und kein chromatischer war. Die
Untertastenfolge mit den ihr eingebundenen Kirchentonarten bildete die diatonische Skala optisch befriedigend ab und machte sie zugleich zum praktischen Gebrauch
geeignet. Die Möglichkeit, chromatische Tonfolgen zu spielen, war nach Einführung der Obertasten zusätzlich gegeben, doch gab es keinen vernünftigen Grund, mit einer
inzwischen über sechshundertjährigen Tradition zu brechen und beispielsweise die Chromatik zu einem Ausgangspunkt der Klaviatur zu machen.
Die Klaviatur bildet in ihrer ursprünglichen obertastenlosen Form die Verknüpfung einer musiktheoretischen Abstraktion, nämlich des diatonischen, kirchentonartlich
geprägten Modus, mit dem Wunsch, diesen durch Tasten und Fingerbewegungen möglichst mühelos in jeder erdenklichen Erscheinungsform ausführen zu können.
Ausgesprochen virtuoses und rein instrumentales Spiel dürfte zunächst noch keine Rolle gespielt haben, und alles diente zunächst wohl der Imitation des Gesanges. Die erst
später hinzugetretenen Obertasten sind Nachträge zwischen den Ganztönen der Untertasten und führen unwillkürlich zu einer versetzten, komplementären Tastenreihe
zweiter Ordnung, deren Gestalt und Tonhöhen aber ganz von den Vorgaben der Untertastenreihe abhängig sind und nur eine lückenfüllend bedingte, sich ergebende, mechanisch verfügte Stellung haben.
Kapitel 2
Klaviatur und Notation
Zusammenhänge von Bespielbarkeit und Lesbarkeit
Im Bereich der bei uns üblichen Notation hat die historische Entwicklung der Klaviatur ein Äquivalent im Fehlen von Vorzeichen bei den Noten der Untertasten, während die
Obertasten nicht eigenständig, sondern einzig auf dem Umweg über die über oder unter ihnen liegenden Tasten und Töne notiert werden können. Versetzungs- und
Auflösungszeichen geben dabei die Richtung des Bezuges nach oben oder unten an. Dies belastet die Chromatik notationstechnisch mit einem Maximum an Vorzeichen und
macht sie besonders dann visuell, auf dem Papier, schwer fasslich, sobald in einer mit Mustern arbeitenden Musik kleine und nicht regelmäßige Abweichungen von einer erwarteten Stufenfolge auftreten. [5] Andererseits kann sich auch das Fehlen von Vorzeichen nachteilig auf Lektüre und Spiel auswirken, da hier die Gestaltenarmut der
Notation mit jener auf den Tasten ähnlich einhergeht.
Der Einbezug von Obertasten kam, zumal bei wachsendem Umfang der Tastatur, der physischen Bequemlichkeit der Fingersätze zugute, denn die Ausführbarkeit nicht nur
chromatischer Tonfolgen wird durch das Auftreten von Obertasten grundsätzlich erleichtert. (Die diatonische Untertastenreihe war die einzige Skala, welche die Abfolge
der Tasten auch optisch verband und nach der Einfügung von Obertasten den Anschlag einzelner Tasten auch ohne jedes Abzählen sofort korrekt erlaubte.) Einerseits
verkürzen sich die Wege zwischen den Tasten auf ein Minimum, andererseits bieten sich vielfach Möglichkeiten zum Daumenuntersatz oder zum Übersetzen längerer Finger
über kürzere. Beides kommt einem geschmeidigen und virtuosen Spiel entgegen und macht die chromatischen Fingersätze grundsätzlich angenehmer als die vieler anderer
Skalen, deren Tastenabstände den Fingerbreiten weniger gut entsprechen.
Dieser Umstand macht sich um so eher bemerkbar, je schneller die Töne aufeinander
folgen. Bei dem Experiment ist zusätzlich zu beobachten, dass beide Skalentypen um so unbequemer werden, je mehr sie sich aus dem Mittelfeld in die Extremlagen des
Instrumentes bewegen und je mehr sich die Hände dabei verwinkeln müssen. Dieser Eigenheit versuchten manche Klavierbauer durch eine strahlen- oder bogenförmige
Anordnung der Tasten zu begegnen (wie Fred Clutsam, 1907 oder Albert Schulz, 1908). [5a] Umgekehrt ist eine Skala um so einfacher spielbar, je mehr sie sich der
Mittellage und einer bequemen, entspannten Sitz- und Spielhaltung nähert. Für die linke Hand sind daher aufwärtsgerichtete Skalen, für die rechte abwärtsgerichtete
grundsätzlich die einfacheren und anatomisch natürlicheren. Unmittelbar ablesbar wird dies, sobald man den oft nur halb bewussten Vorgang des nervösen Fingertrommelns
betrachtet, denn hierbei werden die Finger beider Hände meiner Beobachtung nach stets vom kleinen Finger hin zum ruhenden und in Richtung des die Hand stützenden
Daumen und nie umgekehrt bewegt, was einmal fallende, ein andermal steigende Skalen zur Folge hat, stellt man sich diese Fingerbewegung auf eine Klaviatur übertragen vor.
 |
Gerade der Mangel an Gliederung und die längeren Wege, die die Finger bei jedem
Unter- oder Übersetzen zurückzulegen haben, scheinen mir dafür verantwortlich, dass in traditioneller Musik die Fingersätze der Untertastenskalen die am schwersten erlern-
und erinnerbaren sind, denn jedes Auftreten von Obertasten stellt zugleich eine Art Brücke zwischen den Untertasten dar und bewirkt eine Orientierungs-
und Gedächtnishilfe. Optisch gruppieren die Obertasten die homogene Reihe der Untertasten, machen deren Töne überhaupt erst schnell und zuverlässig auffindbar und
schaffen damit eine der wesentlichen Voraussetzungen, die Tastatur aus der Mittellage heraus in Richtung Bass und Diskant bis zu ihrem heutigen Ambitus systematisch zu erweitern.
Deutlich wird an diesem Punkt, dass ein Unterricht, der auf dem Dur-Moll-System
gründet und mit der vermeintlich „leichten“ und originalen C-Dur-Tonleiter beginnt, primär von der scheinbaren Einfachheit der Untertastenreihe ausgeht und sich am
einheitlichen Weiß von Tasten und Notenbild orientiert. Der Bezug auf das optisch Stimmige ist gleichwohl nur eine Gewohnheit, die vernachlässigt, dass gerade
die konkrete, physische Gestalt der Klaviatur von C-Dur technisch-praktische Schwierigkeiten aufwirft, die es vor allem den kleineren Fingern und Händen junger Spieler schwer macht. Trotz vieler Vorzeichen auf dem Papier liegt unter anderen die Skala in H-Dur bedeutend besser in der Hand als jene in C-Dur: Da in H-Dur
sämtliche Obertasten auftreten, hat man bei der Erlernung nur an die beiden Untertasten h und e als Besonderheiten zu denken, die beide mit Daumenaufsatz
nahtlos auf die zwei Obertastengruppen folgen. Dies fällt umso leichter, als der Daumen beim Skalenspiel grundsätzlich nur auf Untertasten trifft. Das zwischen diesen zwei
weißen Stützen Befindliche ergibt sich gewissermaßen von selbst und ist unabhängig von linker oder rechter Hand. Bei Fis-Dur ließe sich die Abfolge der Tasten und Töne entsprechend mit Daumen auf h und eis, bei Des-Dur auf f und c erlernen. Damit
stellen die Tastengattungen gerade dort, wo die Fülle der Vorzeichen zur Unübersichtlichkeit führt, eine Merkhilfe dar. Vorzeichen oder Tonarten spielen hierbei
nur eine Nebenrolle, denn es geht zunächst nur um die Ausführung, nicht die Aufzeichnung der Anschläge. Hans Joachim Moser empfahl daher, dass man
klavierpädagogisch von der Des-Dur- und H-Dur-Tonleiter als Norm ausgehen solle, „um das Fingersatz-Gefühl von Anfang an richtig zu erziehen.“ [5b] Und Kurt Schubert
(1891–1945) schrieb in seiner von Moser initiierten und in der zweiten und dritten Auflage betreuten Technik des Klavierspiels, dass Chopin in seinem Unterricht das
Tonleiterstudium „bekanntlich“ mit den Tonarten Des-Dur, H-Dur und Fis-Dur begonnen habe. [5c]
Alle fünf Obertasten Untertasten Enharmonische Entsprechung
(Daumen)
H-Dur / Gis-Moll: h – e Ces-Dur / As-Moll: ces – fes
Fis-Dur / Dis-Moll: eis – h Ges-Dur / Es-Moll: f – ces
Cis-Dur / Ais-Moll: his – eis Des-Dur / B-Moll: c – f
Tonleitern mit allen (schwarzen) Obertasten, Mollskalen melodisch abwärts.
Gerade bei Anfängern haben diese Verfahren den Vorzug, dass unter der Hand die Meinung gar nicht erst entstehen kann (oder korrigierend angegangen wird),
eine musikalische Ausführung wäre auf den Tasten umso schwieriger, je mehr Vorzeichen zu berücksichtigen seien. Diese nicht nur landläufige Meinung gründet vor
allem auf dem Bild der Noten und geht von seiner Übereinstimmung mit der Spielbarkeit aus. Was schon schwer zu lesen ist, muss ja auch schwer zu spielen sein.
Dies ist zwar oft auch richtig und gewiss keine Ausnahme, doch ist das Gegenteil ebenso möglich, und ein Skalenspiel, das die Obertasten von Anbeginn einbezieht und
nicht auf „später“ und die Zeiten eines weiter fortgeschrittenen theoretischen Verständnisses vertröstet, weckt den Sinn für die Zusammenhänge von Notenbild und
Ausführung, verlangt nach Übereinstimmung und vermag dank seiner unorthodoxen und konsequenten Herangehensweise mehr Freude am Spiel zu bewirken. In der
Erkenntnis, dass getrennte Bereiche in Einklang zu bringen sind, scheint mir daher vielleicht der Hauptwert des Verfahrens zu liegen, denn es handelt sich um Optik,
Mechanik und Akustik, die vom Spieler individuell zu verbinden und auf die anatomischen Gegebenheiten von Händen und Muskulatur abzustimmen sind. Das
Problem entsteht gewissermaßen zwangsläufig durch eine Übertragung neuerer Musik auf ein in älterer Zeit und für deren Bedürfnisse entworfenes wie entwickeltes
Instrument, von dem man nicht erwarten kann, dass es sämtlichen Anforderungen, musiktheoretischen wie manuellen, gerecht werden kann.
Die Reihe gleich großer weißer Tasten suggeriert darüber hinaus, man habe es auch
akustisch mit einer Reihe gleich großer Stufen zwischen den Skalentönen zu tun. Dieser irreführende Eindruck wird wiederum durch das Notenbild bekräftigt, denn analog
bedeuten hier gleiche graphische Abstände nicht gleiche akustische Intervalle: Die Stufe von einem Notenkopf auf der Notenlinie zu dem benachbarten zwischen den Linien
stellt ebenso wie zwei benachbarte Untertasten einmal einen Ganztonschritt, dagegen ein andermal einen Halbtonschritt dar. Kann man bei den Untertasten zumindest noch
sehen, dass an bestimmten Stellen Obertasten zwischen ihnen liegen, wirkt das Bild der diatonischen Schritte auf dem Notenpapier in sich unstimmig, und man muss sich auf
die Tasten berufen, um dieses Missverhältnis zu erklären. Hans Joachim Moser formulierte es in seinem Musiklexikon (meiner Auffassung nach etwas zu sibyllinisch)
folgendermaßen: „Eine kleine pädagogische Schwäche des Linien-Systems liegt darin, daß es zwischen großer und kleiner Terz nicht unterscheidet, gerade das
Halbtonproblem übergeht und so halb symbolische Verabredung bleibt.“ [5d] Die „Kleinheit“ der Schwäche sei jedoch dahingestellt, denn die Missverhältnisse sind
nicht auf den Halbtonschritt oder die Terz sowie deren Umkehrungen beschränkt: Der Abstand zwischen unterster und mittlerer Notenlinie ist einmal eine Quint (e–h), ein
andermal zwischen mittlerer und oberster Notenlinie ein Tritonus (h–f). Bei den übrigen Intervallen wiederholt sich dies. Man kann daher auch sagen, dass alle Intervalle von
dieser Verfälschung betroffen sind, wobei die Terzen keine Ausnahme sind, denn auf dem vorsichtig beanstandeten „Linien-System“ beruhen nun einmal unsere sämtlichen
musikalischen Intervalle.
Tatsächlich empfinde ich noch immer einen kleinen Unterschied, einerseits in der zu spielenden und andererseits in der zu hörenden Distanz von vier oder fünf
nebeneinanderliegenden Untertasten. Denn sobald ich nach Akkorden in Dur oder Moll, die eine Quinte als Rahmenintervall haben, auf den Akkord h-d-f stoße, der über
genau denselben zu greifenden Tastenabstand verfügt, spüre ich mit der Verkleinerung im Tritonus-Intervall zugleich eine Verringerung der zu spielenden Distanz im Vergleich
mit den übrigen Quinten. Das Umgekehrte geschieht, wenn eine Reihe von Quarten auf den Untertasten zu spielen ist und ich hier ebenfalls auf den Tritonus f-h stoße, wo das
entstehende Intervall plötzlich größer als eine Quart ist. Diese Unterschiede sind aber leicht erklärlich durch den Umstand, dass der eine Tritonus zwei, der andere drei
Untertasten zwischen seinen beiden Tönen hat. Anders ausgedrückt: Einmal bedeutet dieselbe Fingerspannung eine Quart oder einen Tritonus, ein andermal eine Quint oder
einen Tritonus. In der Notation findet sich gewissermaßen das Äquivalent dieses Vorgangs, was im vorangehenden Absatz bereits besprochen wurde (hier). – Die
Hürden der Klaviatur sind daher in Einklang zu bringen mit der Notation, aber auch mit den Fingerspannungen und den hörbaren Intervallen. Diese Schwierigkeiten seien
freilich nicht überbewertet, denn es ist eine Gewohnheit, die nur im Stadium des Erlernens, nicht aber zugleich während einer künstlerischen Darbietung zu bedenken ist. [5e] Gleichwohl kostet das Lernen dieser Besonderheiten Zeit – Zeit, die einem niemand zurückgibt.
Eine Angleichung der Notation an die Gestalt der Klaviatur wurde im zwanzigsten Jahrhundert am konsequentesten Josef Matthias Hauer (1883–1959) versucht, dem es
darum ging, die zwölf gleichberechtigten Halbtöne „in deutlich unterscheidbaren gleichen Stufen angeordnet“ zu sehen und so die „melische Bewegung rasch und sicher“ [6] ablesbar zu machen. Hauer betonte, dass ihm die Kategorisierung der astronomischen Anzahl möglicher Melosfälle erst durch die Verwendung der neuen
Notation einsichtig geworden sei. Eine ganz ähnliche Notation wie die von Hauer, der mehrere seiner Werke zunächst auch in der Zwölftonnotation drucken ließ,
hatte Ferruccio Busoni unter dem Eindruck von Schönbergs Klavierstücken op. 11 (1909) bereits 1910 veröffentlicht, [7] und Johannes Wolf nennt in seinem erstmals
1919 erschienenen Handbuch der Notationskunde nicht weniger als vierzehn Verfasser, die eine an der Klaviertastatur orientierte Notation befürworteten –
beginnend mit Michael Eisenmenger (1838) und endend mit Busoni. [8] Eine sich von Hauer unterscheidende Zwölftonnotenschrift, die mit fünf äquidistanten
Notenlinien arbeitet, entwickelte Othmar Steinbauer (1895–1962) um 1930. [8a] Gleichviel wird hier wohl der zweite Schritt vor dem ersten unternommen,
denn sinnvoller scheint es mir, zunächst das Instrument und seine Klaviatur und dann erst die Notation den aktuellen musikalischen Bedürfnissen wie auch dem
Spielvermögen der Hände anzupassen.
Auch wenn Hauers Werke zum größten Teil in der konventionellen Notationsform vorliegen, so fügte er letzterer jedoch die Besonderheit hinzu, dass die Vorzeichen
jeweils nur für die Note gelten, vor der sie unmittelbar erscheinen, und dass Auflösungszeichen damit entbehrlich sind. Für den Interpreten hat dies den Vorteil,
dass der Notentext insgesamt entlastet wird. In Hauers Klaviersätzen stellt sich umgekehrt eine Lese- und Spielhilfe gerade durch den Umstand ein, dass jedes
Versetzungszeichen zugleich eine Obertaste bezeichnet, da niemals his, eis, ces und fes oder gar Doppelkreuze und Doppel-Bs zur Anwendung kommen. Bei Schönberg oder
in der Folge bei Vertretern des Serialismus dagegen trägt oft jede Note ein Versetzungs- oder Auflösungszeichen, was die Lektüre nicht eben erleichtert. [8b]
Dieselbe Notationsform wie bei Hauer und anderen, die von den Obertasten ausgeht und diese in Form von Notenlinien wiedergibt, lässt sich indes auch bei einem
englischen Geistlichen und Erfinder namens Creed im 18. Jahrhundert nachweisen, allerdings nur als Zwischenstufe und Behelf im Rahmen einer mechanischen
Aufzeichnung des Klavierspiels, wobei besonders improvisierte Musik nachlesbar gemacht werden sollte. Die Beschreibung seiner Erfindung wurde von dem Wundarzt
und Schriftsteller John Freke (1688–1756), der auch mehrere Werke über die Lehre der Elektrizität veröffentlichte, an den Präsidenten der Londoner Royal Society gesandt, der Creeds Text samt John Frekes Begleitschreiben 1747 in den Philosophical Transactions abdrucken ließ. [9]
Abbildung mit höherer Auflösung (62 KB)
Das Prinzip des Aufzeichnungsverfahrens besteht darin, dass die Klaviertasten
mit Schreib-Stiften versehen sind, welche beim Niederdrücken einen mehr oder minder langen Strich auf einer sich drehenden Papierrolle erzeugen. Die in Fig. 1 rechts oben von den weißen
Obertasten ausgehenden Notationslinien ermöglichen ein Transkribieren der Aufzeichnung in die uns vertraute Notation.
Ein musikpädagogischer Ansatz, der, wenn auch nur halb im Scherz, von der
unmittelbaren Tastengestalt als Merk- und Lernhilfe ausgeht und sich damit den Konventionen der Notation entzieht, liegt in dem bekannten Flohwalzer vor, einem „Walzer“ ohne Dreiertakt, bei dem sich die Finger auch eines notenunkundigen Spielers
an der oben genannten Symmetrie der Tastenanlage orientieren können. Ungeachtet der sechs beschwerlichen Vorzeichen auf dem Papier, der Richtlinien des
Quintenzirkels oder komplexer enharmonischer Regeln geht man hier gerade von den Obertasten aus. Gruppieren sich in der rechten Hand die Intervalle dis-cis, fis-ais, f-h
paarweise um den Ton d als Achse, so spiegeln sich die Töne fis, dis, cis beim Übergreifen der Linken über die Rechte um den Ton gis und werden zu ais, cis, dis.
Der Symmetrie-Achsen-Ton gis wird aus der Musik jedoch ganz ausgeklammert, so dass nur 4 Obertasten (dis, cis, fis, ais) und zwei Untertasten f und h benutzt werden,
was bewirkt, dass das Stück insgesamt 6 Tönen heranzieht. Die Abfolge der Töne in der rechten Hand lässt sich von der Gestalt der Hand ableiten, denn die Lücke
zwischen Daumen und Zeigefinger wird der Lücke zwischen ais und cis zugeordnet; andererseits entspricht das Intervall zwischen dis und fis mehr oder minder dem
Abstand des dritten und fünften Fingers. Der Gebrauch des „schwachen“ vierten Fingers wird rechts völlig vermieden, und die Hand bleibt ruhig in ihrer Ausgangslage.
Beim Übergreifen im zweiten Teil wiederholt die rechte Hand den ersten Teil notengetreu und bleibt in ihrer anfänglichen Ruhelage, so dass Gedächtnishilfen,
Tastenanlage und anatomische Gegebenheiten der Hände ineinandergreifen. Neben dem hoquetusartigen Spiel beider Hände, das eine ungeteilte Konzentration auf den
jeweils anstehenden Anschlag einer Hand erlaubt, mag dies alles zur außerordentlichen Popularität des Flohwalzers beigetragen haben. – Ein angelsächsisches Pendant wären
die Chopsticks („Ess-Stäbchen“), eine Musik für die Zeigefinger beider Hände, die in
synchroner Repetition auf den Untertasten aus dem engstem Abstand zweier Tasten (nicht Tonhöhen) bis zur Oktave auseinander- und wieder zusammenrücken.
Grundsätzlich und unabhängig von solch schönen Ausnahmen ist die Klaviatur aber Abbild einer historischen Musikauffassung und -ausübung, Bestandteil einer
mechanischen Apparatur, die infolge sich wandelnder, erweiternder musikalischer Wertungen und Bedürfnisse von der Diatonik zur Chromatik und von der reinen
zur gleichschwebenden Stimmung fortschreitet. Umgekehrt dürften aber auch immer wieder bautechnische Neuerungen (etwa Qualitätsverbesserungen an der Mechanik)
Komponisten zum Gebrauch von Strukturen bewogen haben, die früheren Zeiten noch unzugänglich waren.
Kapitel 3
Klaviatur und Bespielbarkeit
Zusammenhänge von Tastatur und Ausführung
Zwar werden hier nicht alle Möglichkeiten untersucht, die den Zusammenhang einer
Klaviatur und ihrer Bespielbarkeit ausmachen, doch da ein jeder auf einer Tastatur angeschlagene Ton oder Akkord zugleich auch die Wahl von mehr oder weniger
Unter- und Obertasten ist, sei auf das Folgende hingewiesen. Die anatomisch begründete Beweglichkeit zwischen den Gattungen der Unter- und Obertasten, auf der
heute fast alles Musizieren mittels einer konventionellen Klaviatur beruht, ist entscheidend für die Übereinstimmung der Hände mit den Tasten. Das Notierte nach
Vermögen zu meistern und nicht auf sämtliche Eventualfälle vorbereitet zu sein, scheint mir indessen das wesentliche Kriterium der technischen Übungen zu sein. Die Schulung
der Hände ist keine abstrakte und mechanische Angelegenheit eines intensiven Trainings, das alle Hürden vorhersieht, sondern die konkrete, gezielte Behandlung zu
lösender Probleme, die sich in bestimmter Literatur stellen und sich nach intellektueller Durchdringung der Schwierigkeiten mit Hilfe spezieller Übungen manchmal auch besser
angehen lassen. Zu diesem Zweck bilden natürlich optimal durchtrainierte Hände die besten Voraussetzungen, doch muss man wohl, allein um Zeit zu sparen, zunächst
in Erfahrung bringen, was zu welchem Zweck geübt wird. Die Tastengattungen und besonders die Obertasten stehen hier aber weiterhin im Mittelpunkt.
Dabei ist, noch vor der Berührung einer jeden Taste, für den gegenwärtigen Spieler
zunächst ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Unter- und Obertasten zu bemerken: Der Versuch, eine bestimmte Tonhöhe auf den Untertasten zu finden, ohne
die Obertasten zu Hilfe zu nehmen, ist fast unmöglich, sofern man nicht über einen sehr geringen Untertasten-Ambitus hinausgeht oder über ein absolutes Gehör verfügt.
Umgekehrt lässt sich eine bestimmte Obertasten-Tonhöhe vergleichsweise einfach finden, da man sich an den deutlichen Zweier- und Dreiergruppierungen der Obertasten
schnell orientieren kann, und somit sogar eine jede Obertasten-Tonhöhe rasch auffindbar ist, ohne die Untertasten jemals zu gebrauchen. Die Obertasten sind in blindem Spiel ohne die Untertasten sofort identifizierbar, die Untertasten aber fast nur
über die Obertasten. Allenfalls die letzten Untertasten ganz rechts oder links scheinen sich sofort benennen zu lassen, doch geht gerade hier wohl immer eine Orientierung an
den Obertasten voraus, und man bringt dieses Wissen oft schon mit.
Man stelle sich eine Reihe von Untertasten ohne Obertasten vor, um die hierdurch
auftretende Schwierigkeit zu verstehen. Der Vorgang gliche dem Aufschlagen einer bestimmten Buchseite, ohne dabei ein anderes Hilfsmittel als das des Augenmaßes zu
haben; die Obertasten sind dann eine Art von „Lesezeichen“, durch welche eine genauere Orientierung erst ermöglicht wird. Zuvor hätte man bloß sagen können, dass
eine Buchseite mehr vorne, eher in der Mitte oder weiter hinten sei. Bei den Untertasten ohne Obertasten kann man entsprechend zunächst nur angeben, ob Töne
mehr unten, eher in der Mitte oder weiter oben liegen. Die Vorhersagbarkeit, welcher Ton erklingen wird, ist bei den Obertasten jedenfalls ungleich größer als bei den
Untertasten, da man zum einen die Oktavlage ablesen kann, zum anderen innerhalb jeder Oktave eine Eindeutigkeit über die Tonhöhe der Tasten vorliegt.
Wie mühsam gerade Anfängern das Finden des eingestrichenen c als Ausgangston in der Mitte der Untertasten sein kann, zeigt sich durch die Orientierung an dem
Schlüsselloch in oder über der Klappe oberhalb der Tasten, nach dem diese eine Taste gelegentlich auch als Schlüssel-C bezeichnet wird, da in diesem Stadium des Lernens
ein Bezug auf die Obertasten oft noch fehlt. Freilich ist die Sichtbarkeit (nicht die
Hörbarkeit) hierbei das Hauptmerkmal der Tasten, und allenfalls mag die Haptik der Tasten noch eine Rolle spielen. Doch unterscheiden wissenschaftliche Untersuchungen
nur selten, auf welche Weise etwas wahrgenommen wird, solange es sich nicht gerade
um Blinde handelt, mit denen man es ausnahmsweise zu tun hat. Das Wesentliche ist die menschliche Wahrnehmbarkeit, gleichgültig, wie diese Wahrnehmung zustande
kommen mag, und Hauptsache ist, man kann sofort bei dieser Anordnung die Tonhöhen und rasch den Beginn der nächsten Oktave erkennen. Somit wären auch
Blinde dazu in der Lage, jede beliebige Taste mit dem manuellen Gefühl zu finden, sobald es konventionelle Ober- und Untertasten gibt. – Zu einem Fernschreibe-Code, dem sog. Baudot-Code vgl. Anm. [9/9a]
Die heutige Notation steht zu dieser praktischen Erfahrung geradezu in Gegensatz, denn
Einfaches und Eindeutiges auf Seiten der Tasten korrespondiert hier mit Kompliziertem und Vorzeichen bei Obertasten auf Seiten der Notation. Dies führt dazu, dass die
visuelle Seite der Notation gewöhnlich dominiert und der Charakter der Tonarten repräsentativ in den Vordergrund rückt, während die Ausführbarkeit der Tonarten nicht
einmal mehr am Rande in Betracht gezogen und diskutiert wird. Meiner Erfahrung nach beeinflusst die schlechtere oder bessere Spielbarkeit aber durchaus die Wahl einer
Tonart durch die Komponisten – vor allem wenn sie (wie Liszt) selbst Pianisten sind oder waren –, und an den Repetitionen lässt sich dies auch gut zeigen (siehe unten). Nicht allein die Wahl eines Tonartencharakters ist es, die den Komponisten zum
Des-Dur auf dem Klavier greifen lässt, sondern mitunter auch das Vorhandensein einer größeren Anzahl von Obertasten, so dass die Tonart den Spielern manchmal geradezu
hilft, unter anderem Repetitionen auszuführen. Dass vermeintlich „schwere“ Stücke hierbei oft leichter zu spielen sind, als die Notation aufgrund eines Übermaßes an
Vorzeichen vermuten lässt, ist eine Erfahrung, die manchem Theoretiker der Tonarten offenbar abgeht. So wird ein zentraler Bereich der Musikausübung geradezu
ausgeklammert, der eine Tonart wählte, um Dinge in Noten, Tasten und Fingern praktikabler umzusetzen, während die Lesbarkeit zugleich erschwert ist. Natürlich kann
es auch vorkommen, dass Repetitionen nicht im Vordergrund stehen und dass das Des-Dur anderer Eigenschaften wegen von einem Komponisten herangezogen wurde.
Aber die Vernachlässigung des Umstandes, dass manche Tonart wegen ihrer Ausführbarkeit und nicht anderer Dinge wegen gewählt wurde, scheint mir unübersehbar.
Dies führt weiterhin zu der Frage, ob die Ausführbarkeit der Musik und ihre
Verbundenheit mit der Tastengestalt überhaupt wahrgenommen werden, und dabei zeigt sich nicht allein die außerordentliche Abhängigkeit der Forscher, Leser, Spieler
und Hörer von einer bildhaften Darstellung der Musik in der Notation, sondern diesem Aberwitz ist es auch zu danken, dass immer wieder Komponisten auftreten und
vollmundig von sich sinngemäß behaupten, das „schwerste Stück“ für Klavier unter der Sonne geschrieben zu haben – wobei sie eher von der ihnen vertrauteren
Lesbarkeit, doch kaum der ihnen fremderen Spielbarkeit der Musik sprechen. Es ist ja kein Verdienst, „schwere“ Musik geschrieben zu haben, sondern es ist nicht mehr und
nicht weniger als eine Sackgasse der Musik, die aus der Vergegenwärtigung des Vergangenen lebt. Man braucht ja nur Schicht auf Schicht zu türmen, bis schließlich
auch der beste, fähigste und gutwilligste Interpret das Handtuch wirft und das geschriebene Werk kurzerhand als „unspielbar“ bezeichnet: oft genug zur großen
Genugtuung der Komponisten, die ja schon immer wussten, in welch guter Gesellschaft sie sich bewegen. Die „Schwerheit“ der Ausführbarkeit kann nie ein Maßstab werden,
an dem Musik sich zu beweisen hätte, doch ebenso würde man das Gegenteil, die „Einfachheit“, nicht zur Grundlage von Musik machen wollen. Beides kann einmal
richtig, ein andermal falsch sein, doch gibt es dafür kein Rezept, wie man Kunst schafft. Beides kann stimmen, solange es man nicht verabsolutiert und es stets „den Anderen“
als was auch immer für eine Vorschrift aufbürdet.
Aber zurück von solch unsinnigen Eitelkeiten zu Wichtigerem: Es ist durchaus möglich,
dass die Ausführung sehr schneller Repetitionen auf dem Klavier eine periphere Erscheinung ist; in ähnlicher Weise wäre aber weiteren Phänomenen des Klavierspiels
nachzugehen und ihre Verbundenheit mit den Tonarten, in denen sie stehen, zu prüfen.
Die einheitlich „weiße“ Farbe der Untertasten ist gleichwohl maßgeblich für die heutige
Grundlage des Klavierspiels, wenn die Erfahrung auch Anderes zeigt. Doch ist gerade die Gleichartigkeit der Untertasten verantwortlich für die Schwierigkeit ihrer Erfassung
durch die Spieler. Die Untertasten waren bei ihrer Erfindung ja auf einen kleinen Ambitus beschränkt, und in diesem Rahmen, in dem es Obertasten noch gar nicht gab,
konnte man die Menge der Tasten noch gut einschätzen oder sogar abzählen. So könnte man behaupten, dass die Ausdehnung der Klaviatur nach links oder rechts, zum
Diskant oder Bass hin, zugleich zu einer Verschiebung der Wahrnehmung von den Unter- zu den Obertasten geführt habe, denn ehedem spielten allein „Tasten“
(Untertasten) in kleinem und überschaubarem Ambitus eine Rolle, während heute, vor allem nach dem 19. Jahrhundert, die Obertasten im Sinne einer Vergrößerung des
Instruments mit bis zu acht vollen Oktaven (57 Unter- und 40 Obertasten; gewöhnlich 52 Unter- und 36 Obertasten) auf der Klaviatur in den Vordergrund treten. Erst um
1900 herum waren die Instrumente völlig „groß geworden“. Nebenbei sei bemerkt, dass sämtliche mir bekannten Klaviaturen (egal ob bei Flügeln, Klavieren, Cembali
oder Orgeln) am linken und rechten Ende mit Untertasten, nie aber mit Obertasten schließen – vielleicht aus ästhetischen, farbpsychologischen oder anderen Gründen.
Freilich kann man die Vergangenheit nicht einfach korrigieren, und so muss
man die Schritte der Anpassung, die an den Klaviaturen vorgenommen wurden – Erweiterungen (von Vortragssälen wie von Instrumenten) oder Verkürzungen (in der „kurzen Oktave“) – erst verstehen. Beides sind gute Beispiele, dass und wie
man die Instrumente auf die von der Ausübung der Musik gegebenen Bedürfnisse abstimmte und die Bauweise der Instrumente sowohl den räumlichen Verhältnissen wie
den innermusikalischen Überlegungen anglich. Doch hat man, gleich allen anderen Instrumenten, die mit Klaviaturen bespielbaren Instrumentein in ihrer geschichtlichen
Befangenheit und Bedingtheit zu sehen, nicht als quasi abstrakte Tonerzeuger und gefühllose Werkzeuge, die alles können, was man von ihnen wünscht, sondern die
zu jeder Zeit bestimmte musikalische Bedürfnisse erfüllten.
*
Hinsichtlich der Bespielbarkeit der Tasten lässt sich an den Tonrepetitionen bereits
einiges bemerken. Der Vorgang kündigte sich in den Vorzeichen schon an – die ersten
5 Vorzeichen, ob nun Kreuze oder Bs, stellen ja immer die 5 Obertasten dar –, ist also von den Tonarten abhängig, die sich für bestimmte Zwecke umso besser verwenden
ließen, über je mehr Obertasten sie verfügten. Dass mehrere der sich hier anschließenden Beispiele aus einer Epoche stammen, in der die Gesetze der
Funktionsharmonik noch gültig und Tonartenvorschriften üblich waren, verdankt sich unter anderem diesem Umstand. Man könnte mit etwas Übertreibung sagen, dass
Komponisten die gewählten Tonarten heranzogen, um mit ihrer Hilfe und durch Gebrauch ihrer Klaviatur-Eigenschaften die Treffsicherheit der Finger auf den Tasten zu
steigern. Dies war natürlich in Musik von hoher Geschwindigkeit eher der Fall wie auch in solcher, welche Tonrepetitionen in schnellem Tempo einbezog, die sich nun einmal
infolge der größeren Bewegungsfreiheit der Finger und Hände besser auf Obertasten als auf Untertasten ausführen lassen. Die Obertasten ragen ja aus den einheitlich auf
einer Ebene schließenden Untertasten räumlich hervor. (Weitere Eigenschaften der Obertasten werden hier genannt.) Man braucht aber nicht lange zu suchen, um
dergleichen vor allem in Literatur der Klaviervirtuosen des 19. Jahrhunderts zu finden, denn selbst ein schnelles Durchblättern der Werke lässt Tempoangaben und
Repetitionen im Notenbild erkennen. Für die Wahl der Tonart waren aber offenbar ganz praktische Gesichtspunkte ebenso der Überlegung wert wie ästhetische
Einschätzungen über die Charaktere verschiedener Tonarten.
Zu nennen wäre hier die Konzert-Etüde La Campanella nach Niccolo Paganini,
die Franz Liszt zunächst in A-Moll und As-Moll, später in der endgültigen Form aber in Gis-Moll notierte. (Das Thema stammt aus dem Finalsatz von Paganinis zweitem
Violinkonzert in H-Moll von 1826.) [9a] Das in diesem Haupttext hinsichtlich der
Obertasten Gesagte trifft daher am ehesten auf die endgültige Niederschrift des Werkes in Gis-Moll zu. Im Vergleich zu Paganini erschwerte Liszt durch seine
Notation zwar teilweise die Lektüre, doch im Wissen darum, dass ein Lesen von Noten im Augenblick einer konzertierenden Aufführung gar nicht möglich ist,
erleichterte er das Geschriebene, indem er die Tonart auf die Vorgaben von Händen und Klaviatur abstimmte. So begann er die Musik auf der Obertaste es oder dis, die im
Verlauf des Stückes immer wieder von der rechten Hand in teilweise sehr weiten und raschen Sprüngen zu erreichen war, und kam einem fehlerlosen Spiel durch die gute
Sichtbarkeit dieser Taste sowie die Bewegungsfreiheit infolge des größeren Abstandes zur nächsten Obertaste (fis) entgegen. Hinzu kam aber wohl die Überlegung, dass
Gis-Moll mit seinen fünf Kreuzen wesentlich besser zu dem Charakter des Stückes und dem „Glöckchen“ passte als As-Moll mit seinen sieben Bs, wo jeder Ton der abwärts
führenden melodischen Skala mit einem Vorzeichen versehen ist und die Pianisten vielleicht zuerst an den Trauermarsch in Beethovens Klaviersonate op. 26 denken lässt.
Liszts Transposition des Campanella-Themas von der originalen Tonart in H-Moll zu A-Moll, dann zu As-Moll und schließlich zu Gis-Moll geschah primär nicht einem
Tonartencharakter zuliebe, sondern aus dem Grund, die Repetitionen auf den Obertasten besser (mit einem Minimum an Vorzeichen) ausführen zu können. Die
Fehlerfreiheit war hier wichtiger, wodurch gegenüber dem Original zugleich eine Kreuztonart beibehalten werden konnte und diese über nur drei Kreuze mehr als das Original Paganinis verfügte.
Ähnlichen Überlegungen im Hinblick auf die benutzte Tonart begegnet man in Franz Liszts Ungarischer Rhapsodie Nr. 2 in Cis-Moll (erschienen 1851), wo in Friska die linke Hand mehrfach über die rechte greift, um dann im Diskant begleitende
Obertasten anzuschlagen. Der Passus gehört zu einem Abschnitt des Stückes, der über zwei Seiten lang das cis beibehält – oft in schneller Repetition, später im Oktaven- und
schließlich im Zwei-Oktaven-Abstand. Läge der Ton cis auf einer Untertaste, wäre
diese Musik meiner Einschätzung nach erheblich schwieriger zu spielen, und größere Vorsicht wäre vonnöten, denn zwei nebeneinander liegende Untertasten sind wegen
ihres geringeren Tastenabstands leichter versehentlich anzuschlagen als zwei nebeneinander liegende Obertasten. Dennoch ist diese populäre Rhapsodie Liszts
mehrfach auch in der vermeintlich „leichteren“ Tonart C-Moll herausgegeben, aus der Berücksichtigung welcher Interessen auch immer. Sichtlich ist aber die Lesbarkeit
höher bewertet als die Spielbarkeit. So kann man nur dankbar sein, dass diese „Erleichterung“ um einen Halbtonschritt nicht auch Franz Liszts Rigoletto-Paraphrase
von Des-Dur nach C-Dur oder Ludwig van Beethovens „Appassionata“ von F-Moll nach E-Moll zuteil wurde, von deren Obertasten-Verwendung weiter unten die Rede ist. [9b]
Ebenso handelt es sich bei den folgenden Absätzen, die vor allem aus dem
Klavierwerk von Liszt stammen, um Techniken, die dem Pianisten die Ausführung des in der Notation Festgelegten zum Teil erleichtern (Repetitionen sind dabei nur unter
anderem zu finden) – allemal werden aber hier die Eigenschaften der Obertasten benutzt, die das schnelle und sichere Auffinden bestimmter Töne (linke Hand springt
über die rechte) bequemer machen und die nicht nur für eine Begleitung, sondern auch thematisch herangezogen werden können. Schließlich werden die Obertasten auch von
Komponisten (Chopin, Liszt, Balakirew) in einer Art von Hommage zusammengefasst, wobei Bezug genommen wird auf einen jedem Klavierspieler vertrauten Klang. Erst im
Anschluss an diese Behandlung, geht es mit den Repetitionen weiter, und es werden Beobachtungen aus dem 20. Jahrhundert vorgetragen, welche die Methode Liszts aber bestätigen.
So stammt von Franz Liszt die 1848 komponierte Konzert-Etüde Nr. 3 (bekannter als
„Il Sospiro“ [der Seufzer]), in welcher die linke über die rechte Hand greift, um im Wechsel mit dieser Melodie und Thema zu spielen. Auch dieses Stück mit
5 Obertasten steht in Des-Dur, so dass man gar behaupten könnte, die Wahl einer Tonart lege das Übergreifen der Hände nahe, oder anders ausgedrückt: das
Übergreifen der Hände lasse Des-Dur oder eine andere Tonart mit vielen Obertasten wählen. [9c] Man denke an die Klavierbegleitung (große laute Akkorde zu Anfang) in
Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1, die in Des-Dur, nicht in B-Moll, steht. Des-Dur liegt hier besser in der Hand als jede Tonart mit wenigen Obertasten.
Nebenbei sei Franz Liszts Transkription über Verdis Oper Rigoletto von 1859
gedacht, welche hauptsächlich ebenfalls in Des-Dur steht. Besonders gegen Schluss transponieren die Oktaven, in denen beide Hände fortschreiten, die fünf Obertasten b-as-ges-es-des-(b) [etc.] zu den leitereigenen und eine Quarte tiefer liegenden Tönen f-es-des-b-as-(f) [etc.]. Dieses Ende erinnert auch an das Ende der Vision, der
sechsten von Liszts Etudes d’exécution transcendente (1837/38), wo im vorletzten Takt eine Parallele in einem Oktavengang der linken Hand auffindbar ist.
Die Pentatonik der fünf Obertasten setzt Liszt hier jedoch einen Halbton höher, so dass aus den Obertasten b-as-ges-es-des-(b) die Untertasten-Oktavfolge h-a-g-
e-d-(h) wird. Die „Hommage an die Obertasten“ wird hier also ausschließlich von Untertasten erbracht und hat bereits etwas von einem Zitat. [9d] – Man vergleiche bei M. A. Balakirew eine ähnliche Technik in seiner 1869 komponierten Suite Islamej. [9e] Dass die Benutzung aller fünf Obertasten bereits von Frédéric Chopin am Ende
seiner Etüde op. 10, Nr. 5 in Ges-Dur in der Originalgestalt verwendet wurde, sei nur beiläufig erwähnt, da es sich um ein sehr populäres Beispiel handelt (Chopins Etüden
op. 10, 1829–1832 komponiert, sind Franz Liszt gewidmet).
Mehr zu den Repetitionen: Von Franz Liszts Errungenschaften auf dem Gebiet der
Repetitionen weiß ich nicht einmal, ob sie bewusst oder unbewusst entstanden sind. Zu seinen schwierigeren Übungen zählten sie aber gewiss, denn in einem Brief an den in
Genf lebenden Pierre Wolff (junior) schrieb er am 2. Mai 1832 aus Paris: „[…] besides this I practise four to five hours of exercises (3rds, 6ths, 8ths, tremolos,
repetition of notes, cadences, etc., etc.).“ (im Original in französischer Sprache) [9f]
Der erste Satz von Beethovens Klaviersonate in F-Moll („Appassionata“) op. 57 von
1804/05 enthält zahlreiche Ton-Repetitionen, die erst auf es, später auf as auszuführen sind (ein in der Reprise repetiertes c findet indes auf einer Untertaste statt). Die
Tonfolgen besitzen freilich nicht Liszts hohe Geschwindigkeit.
Als weiteres Beispiel sei Maurice Ravels Alborada del gracioso aus den Miroirs
(1904–1905) angeführt, denn die hier verlangten schnellen Tonrepetionen liegen vornehmlich auf gis und fis und somit auf Obertasten. [9g] Deutlich werden auch die beiden Tasten-Ebenen in die Komposition aufgenommen, indem das fis in der linken
Hand beibehalten wird, während das Spiel der rechten Hand die linke immer wieder unterläuft und eine eigene, rhythmisch und harmonisch weitgehend unabhängige Schicht
bildet, die bereits orchestrale Züge trägt (etwa S. 38). Später wurde das Werk vom Komponisten in einer Weise instrumentiert, die glauben lässt, er habe bei dem früher
entstandenen Klavier-Solostück bereits an eine Orchester-Fassung gedacht.
Dass der Anfang von Mili Alexejewitsch Balakirews (1836–1910) orientalischer Suite Islamej [Islamey] op. 18 von 1869 (rev. 1902) gerade in Des-Dur steht, dürfte auch
diesen beschriebenen Hintergrund der Tonrepetitionen auf den Obertasten haben, die in diesem Stück immer wieder auftreten. Balakirew war zwar manchmal von Chopin
und Liszt beeinflusst, aber seine Originalität sei keineswegs in Frage gestellt (vgl. oben).
Eine Überlegung scheint mir noch wert, im Rahmen der Repetitionen mitgeteilt
zu werden. Unübersehbar ist, glaube ich, der Längenunterschied zwischen Ober- und Untertasten, der nur approximativ durch Bleinieten im Tasten-Inneren ausgeglichen
werden kann. Geringe Abweichungen von einem errechenbaren Wert könnten bei einer großen Menge von gleichen Anschlägen durchaus ins Gewicht fallen. So habe ich bei einem auf YouTube festgehaltenen und veröffentlichten Test einen Spieler, den
ungarischen Pianisten Bence Peter, bei der schnellstmöglichen Tonrepetition auf einem Flügel (Bösendorfer ENG SUB, eine Bezeichnung, die ich nicht kenne) beobachtet.
Dabei war eher an seinem Vorspiel, in dem der später repetierte Ton mehrfach als Grundton auftrat, erkennbar, ob Bence eine Ober- oder Untertaste für seine
Repetitionen benutzte, als an dem eigentlichen Test. Doch ich prüfte zumindest die Tonhöhe an einem eigenen Flügel nach und schlug den richtigen Ton als eingestrichenes cis an, der auch von Bence repetiert wurde (vgl. hier). [9h]
Mit einer gewissen Übertreibung ließe sich aus dieser Sicht sogar der französische
Impressionismus von Ravel und Debussy als Gegensatz zu Schönbergs atonalem (1909) und dann zwölftönigem Komponieren (1921) begreifen, da die Tastengestalt bei den
Impressionisten als Spielbarkeit in den Klaviersatz eingeht, bei Schönberg indes, gleich allem anderen an Tonhöhen zufällig Vorfindbaren, wie bei einem abstrakten Instrument
hingenommen und vollständig eingesetzt wird (es mag zum Teil daran liegen, dass Schönberg kein Pianist war). Bei Liszt scheinen mir diese Gegensätze noch vereint zu
sein, doch ist auch dies eine Art der Stilisierung, die ihm so wenig wie die Bemerkung zu den Impressionisten oder Schönberg gerecht werden kann; vielleicht ist es mehr eine
Frage einzelner Werke. Festzuhalten bleibt jedoch, dass man sich der Tastengestalt auch in anderer Funktion als in der deutschen, später sogar mathematischen
Gleichberechtigung bedienen kann, deren Eigenschaften zum Teil die Folgerichtigkeit, die Konsequenz und schon gleichsam wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit zu sein scheinen.
Damit ist auch einer der Umstände genannt, die Literatur der Vergangenheit nicht auf
neue, experimentelle Klaviaturen zu übertragen, denn die Beziehung zwischen Klaviatur und ihrer Musik ist zu respektieren und keine beliebige, die auf allen zwölf Stufen der
chromatischen Skala gleich gute Resultate erbrächte. Musik und Klaviatur, welche von Komponisten, die noch selbst ihre Spieler waren, oft als Einheit betrachtet wurden
(Transposition nur als Kompromiss), sind untrennbar miteinander verbunden, und die Auflösung dieser Bindung käme zumindest hier einer Bearbeitung gleich, wäre
manchmal vielleicht sogar ein Verstoß gegen die Musik. Andersartige Klaviaturen mögen neue Dinge ermöglichen, doch auf ältere (nicht abgenutzte oder schadhafte)
Klaviaturen zu verzichten, nur weil sie in derselben Zeit wie die auf ihnen entstandene Musik gebraucht wurden, scheint mir verfehlt und dem Irrtum zu verfallen, dass mit der
Zeit notwendig alles besser werde. Dasselbe gilt vielleicht sogar für die anatomische Ausbildung der Hände, die nicht jeden beliebigen Stil mit derselben Vollkommenheit wiederzugeben vermögen.
Das mechanische Übernehmen einer Zwölftonreihe auf sämtliche Stufen einer
Grundreihe mag in seiner theoretischen Form zwar angehen und für elektronische Musik besser zu rechtfertigen sein; das Verfahren sträubt sich jedoch gegen eine
Übernahme der Musik auf eine andere Stufe der Klaviatur, denn die Verhältnisse der Hände auf den Tasten sind andere. Man komponiert ja in erster Linie nicht für das
Papier, sondern für spielende Hände und hörende Ohren. Im orchestrierten Satz würden die höchsten wie die tiefsten Töne fraglich sein, da nicht jedes Instrument in der
Lage ist, dieselben überhaupt zu produzieren, während diese Charakteristik bei einer jeden Transposition verlorengehen könnte. Dies gilt natürlich ebenso für sämtliche
Transpositionen tonaler Musik – jeder Fall ist hingegen verschieden und bedarf seiner eigenen Überlegung und Lösung. In Fragen wie dieser lasse ich mich daher gerne vom
Gegenteil des vielleicht allzu abstrakt Gesagten überzeugen.
Kapitel 4
Erneuerungen der Klaviatur, experimentelle Tastaturen
Gleichwohl eröffnen sich an dieser Stelle neue Möglichkeiten. Eine nicht diatonisch,
sondern chromatisch begründete Klaviatur könnte etwa die 12 Halbtöne regelmäßig alternierend auf Unter- und Obertasten verteilen, so dass sich die zwei möglichen
Formen der Ganztonleitern als Tastengattungen gegenüberstehen (Obertasten hier türkis, Untertasten rötlich, zwei c farblich hervorgehoben):
|
|
cis
|
|
dis
|
|
f
|
|
g
|
|
a
|
|
h
|
|
cis
|
|
dis
|
|
f
|
|
|
c
|
|
d
|
|
e
|
|
fis
|
|
gis
|
|
ais
|
|
c
|
|
d
|
|
e
|
|
fis
|
|
Dieses System wurde – mit vertauschter Unter- und Obertastenreihe – bereits 1843
von William A. B. Lunn unter dem Pseudonym Arthur Wallbridge als Alternative zur diatonisch geprägten Klaviatur entwickelt. Er nannte es „sequential keyboard“
(sequenzierende Tastatur), und später propagierten und modifizierten andere das System mehrfach, wobei besonders Paul von Janko [Jankó] (1856–1919) zu nennen ist. [10] Auch die Schriften von Heinrich Josef [Joseph] Vincent (1819–1901) [eigentlich „Winzenhörlein“] gehören in diesen Zusammenhang. Vincent propagierte in
seiner Broschüre Die Neuklaviatur (1875) radikal die chromatische Anlage der Tastatur (das c fiel auch hier auf eine Obertaste), [10a] und Martin Vogel (1923–2007) betrachtete Vincent daher als einen der geistigen Wegbereiter der Wiener Zwölftonlehren im zwanzigsten Jahrhundert. [10b] Vincent verweist in seiner genannten Schrift darauf (S. 24), dass er „zugleich mit Bernhard Schumann (Arzt in
Rhinow bei Rathenow [in der] Mark Brandenburg) auf die Neuklaviatur gekommen“ sei und betont an anderer Stelle (S. 19), dass Bernhard Schumann „vor 15 Jahren“ [in
seinem Buch von 1859] bereits die Neuklaviatur in Vorschlag gebracht habe.
Karl Bernhard Schumanns System [10c] ist in Franz Diettrich-Kalkhoffs Geschichte der Notenschrift (1907) neben noch anderen experimentellen Klaviaturen genannt,
doch da in dieser Quelle (Tafel XVIII [die Tafeln sind nicht in dem Exemplar des Internet Archive vorhanden]) die Notennamen verwirren, sei die Abbildung aus
Schumanns Schrift aus dem Jahre 1859 ergänzt, wo sich auch eine Erklärung der Klaviatur befindet. [10d].
Karl Bernhard Schumanns Tastatur (1859) mit 2 + 4 Obertasten und 3 + 3 Untertasten
Um die Oktavlagen der Töne leichter zu identifizieren, könnten beispielsweise die Untertasten eines jeden c rot eingefärbt sein (siehe vorstehende Tafel) [10e], oder man färbt je sechs chromatisch aufeinanderfolgende Tasten schachbrettartig schwarz und
weiß ein, wobei zugleich die gesamte Klaviatur durch die Wiederholung des Musters übersichtlich gegliedert würde (türkis hinterlegte Töne = schwarze Tasten, die übrigen weiß):
|
|
cis
|
|
dis
|
|
f
|
|
g
|
|
a
|
|
h
|
|
cis
|
|
dis
|
|
f
|
|
|
c
|
|
d
|
|
e
|
|
fis
|
|
gis
|
|
ais
|
|
c
|
|
d
|
|
e
|
|
fis
|
|
Dieses Prinzip, das hier mangels praktischer Erfahrungen nur als gedankliches Modell
herangezogen wird und das ich daher im Augenblick weder propagieren noch favorisieren möchte, reduziert beispielsweise Transponierungsschwierigkeiten von den
zwölf möglichen Fällen (Oktavtransposition mitgerechnet) auf nur zwei, da die einzige Voraussetzung für eine Verwendung identischer Fingersätze der Beginn der
Transposition in derselben Tastengattung wie die zu transponierende Musik ist. Für die verbleibende Tastengattung bedarf es eines zweiten Fingersatzes. Eine vollkommene
Transponierbarkeit mit einem einzigen Fingersatz wird erst durch Gebrauch einer einzigen Tastengattung möglich oder durch ein komplexeres System wie etwa von
Jankos Klaviatur. Im Hinblick auf die Transponierbarkeit auf dem Klavier, die wie bei den meisten anderen Instrumenten auf grifftechnische Probleme stößt, nähert man sich
hier jenen klaviergeschichtlichen Versuchen (schon seit 1600), durch eine Verschiebung der Spielmechanik (wie beim Una-corda-Pedal) Tonarten ohne jede
Änderung von Fingersätzen und Griffen zu transponieren. Die Verschiebung bewirkte offenbar Transpositionen bis um eine volle Oktave. [11]
Zwar gibt es für die Transponierbarkeit derzeit keinen hervorgehobenen Bedarf, doch
rücken diese Überlegungen die enge Verbindung von Transposition und Fingersatz (Anschlagsart) wieder ins Licht. Die Neuordnung der Finger auf den Tasten ist für den
Transponierenden das zentrale Problem, zu dem, sofern man das Original nicht auswendig kennt, die Entzifferung und Umdeutung von Intervallen hinzukommt. Dass
ein von C- nach Cis-Dur transponiertes Stück anders klingt, hat seine Ursache dabei nicht nur in der physikalisch-akustischen Anhebung aller Tonhöhen, in neuen Oberton-
und Resonanzverhältnissen im Innern des Instrumentes und so weiter, sondern darüber hinaus auch in veränderten Fingerspannungen, welche die Ausführung zum Teil
erleichtern, zum Teil erschweren, hier eine Übernahme der alten Fingersätze erlauben, dort neue erzwingen.
Die Transposition verursacht stets eine Veränderung der Spielart, die auf die Finger
gelegentlich wie das Spiel auf einem fremden Instrument wirkt, dessen Eigenheiten, Vorzüge wie Nachteile, erst kennen zu lernen sind. Die Tonart verschmilzt mit den
Fingerbewegungen auf den Tasten zu einer unauflöslichen Einheit, und so könnten durch den weitgehenden Verzicht auf neue Fingersätze bei einer chromatischen
Tastatur die Eigenfarben der Tonarten unverstellter, in gleichsam neutralisierter Form hervortreten. Die Transposition ist gleichzusetzen mit einer spezifischen Modifikation
der Interpretation und wird stets ein Element derselben, ob man dies als Hörer wahrnimmt oder nicht. Ebenso deutlich ist, dass auch das verwendete Klaviatursystem
durch die Charakteristik seiner Bespielbarkeit stets ein Bestandteil der Interpretation sein wird.
Wichtiger wäre vielleicht, dass gleiche Intervalle gleiche Strecken auf der Tastatur
in Anspruch nehmen und die akustischen Abstände zwischen den Tönen denen auf den Tasten besser entsprechen. Die diatonische Tastenanlage verzerrt die Intervalle, denn
da bereits die kleine und große Sekund auf den Untertasten gleich großen Raum einnehmen, überträgt sich die Irritation auf alle anderen Intervalle (siehe oben).
Als Notation der chromatisch regelmäßig alternierenden Tastengattungen käme vielleicht ein Notensystem mit sechs äquidistanten Linien in Frage, wobei die
Notenköpfe zwischen den Linien die Untertasten, die auf den Linien die Obertasten bezeichnen könnten. [11a]
Zusätzlich sei angeregt, die Stimmung des Instrumentes im Sinne einer Enharmonik zu
modifizieren: Die ohnehin in den Vordergrund tretende Chromatik könnte hierbei sogar eine Vervollständigung erfahren, da sich die enharmonischen Halbtöne zwischen den
diatonischen Ganztönen grundsätzlich einbeziehen lassen (c, d, e, f, g, a, h; cis, dis, fis, gis, ais; des, es, ges, as, b sowie fes und ces). [12] Eine von vielen Möglichkeiten könnte beispielsweise so aussehen, dass die zwölf Töne einer Oktave alternierend
einmal mit den erhöhten, einmal mit den erniedrigten Intervallen eingestimmt werden (Aufteilung in Ober- und Untertasten wie oben):
|
|
cis
|
|
dis
|
|
f
|
|
g
|
|
a
|
|
h
|
|
des
|
|
es
|
|
f
|
|
g
|
|
a
|
|
h
|
|
c
|
|
d
|
|
e
|
|
fis
|
|
gis
|
|
ais
|
|
c
|
|
d
|
|
e
|
|
ges
|
|
as
|
|
b
|
|
|
Andere Verteilungen auf die Oktavlagen sind natürlich ebenso denkbar und hängen von den musikalischen Zielen ab, die man im einzelnen verfolgt.
Fortsetzung Teil 2
Anmerkungen zu Teil 1
[1] Herbert Henck, Klaviercluster. Geschichte, Theorie und Praxis einer
Klanggestalt (Reihe Signale aus Köln, Beiträge zur Musik der Zeit, hg. von
Christoph von Blumröder, Band 9), Münster: Lit-Verlag, 2004, S. 135 f.
[2] Vgl. Hans Joachim Moser, [Artikel] Diatonik – Chromatik – Enharmonik (Spalte 403–409), in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd. 3, © 1954,
Reprint 1989, Sp. 404.
[3] Zu den Breitenunterschieden der einzelnen Tasten, die sich leicht mit einem Nonius
nachmessen lassen, vgl. Nicolas Meeùs, [Artikel] Keyboard (Seite 381 bis 383), in: The New Grove Dictionary of Musical Instruments, [Volume] 2, G to O, London
1984, Seite 382–383: 2. Layout.
[4] Vgl. dazu den Aufsatz des Verfassers Klavierglissandi. Ein Beitrag zur experimentellen Pianistik (= S. 70–98), in: ders., Experimentelle Pianistik.
Improvisation, Interpretation, Komposition. Schriften zur Klaviermusik (1982 bis 1992), Mainz (u. a.): B. Schott's Söhne (Editionsnr. ED 8152), 1994; hier besonders
S. 90–95 das Kapitel V: Das echtchromatische Glissando.
[4a] Hans Joachim Moser, Bernhard Ziehn (1845–1912). Der deutsch-amerikanische Musiktheoretiker, in: Jahrbuch der Musikwelt. The Yearbook of
the Music World. Annuaire du monde musical, hg. von Herbert Barth, Redaktion: Richard Schaal, 1. Jg. (1949/50 [mehr nicht erschienen]), Bayreuth: Verlag Julius
Steeger, 1949, S. (208)–298; hier S. 227–228 (hier auch die beiden Abbildungen).
(Der Aufsatz erschien unter demselben Titel im selben Verlag 1950 als separate Veröffentlichung.) Einem musikpädagogisch orientierten Gebrauch der Symmetrien von
Tasten begegnet man auch in folgendem Buch: Helmut K(arl) H(einz) Lange (geb. 1928), So spiele und lehre ich Chopin. Analysen und Interpretationen, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1993, hier S. 42 ff. (Kapitel 7: Das Palindrom) sowie S. 132
im Abschnitt Die doppelgriffigen chromatischen Tonleitern.
[4b] Ebd., S. 227. Auf die symmetrischen Skalen und Akkorde kommt Moser auf
Seite 287 ff. zu sprechen. – Ferruccio Busonis Aufsatz Die ‘Gotiker von Chicago, Illinois’ ist am Ende der folgenden Anmerkung [4c] erwähnt (vgl. Google Books, S. 396, rechte Spalte, mit Quellenbeleg).
[4c] Siehe besonders: Bernhard Ziehn, Canonical Studies. A New Technic in
Composition. Canonische Studien. Eine neue Compositions-Technik, Milwaukee, Wis[consin]: W[illiam] A. Kaun Music / Berlin, Germ[any]: Richard Kaun Musik
Verlag, Copyright 1912 by Emma Ziehn, II + 210 S.; deutsch-englische Ausgabe; Download unter http://archive. org/details/canonicalstudies00ziehuoft. Zu Ziehn vgl.
auch Bernhard Ziehn, Manual of Harmony, theoretical and practical, Vol. I [„the second volume survives in manuscript“], Milwaukee, Wis.: Wm. A. Kaun Music /
Berlin, Germ.: Richard Kaun Musik Verlag, Copyright MCMVII [1907] by Bernhard Ziehn, 115 S., englische Ausgabe; Download unter: http://archive.org/details/manualharmonyth00ziehgoog. Siehe auch den Abschnitt Bernhard Ziehn
(1845–1912), in: David Damschroder / David Russell Williams, Music theory from Zarlino to Schenker. A Bibliography and Guide, Stuyvesant, NY: Pendragon Press,
1990 (Harmonologia Series, No. 4), S. 395 f.; Teil-Download bei Google Books.
[4d] Vgl. die mp3-Midi-Wiedergabe sowie die Partitur als pdf-Datei. Auf der Webseite Recordings of Kyle Gann’s Music ist auch ein Kommentar zu der Chicago
Spiral zu finden.
[5] Vgl. zu diesem Problem vom Verfasser den Aufsatz Notation als Fehlerquelle. Idiosynkrasien eines Interpreten, in: Experimentelle Pianistik, a. a. O. (Anm. 4), S. 105–110.
[5a] Vgl. Karl Jung und Hubert Unverricht, Artikel Klavier, in MGG 7 (1958),
Abbildung 14 in Spalte 1114 (Bogenklaviatur und Strahlenklaviatur) sowie Text-Sp. 1117.
[5b] Hans Joachim Moser, [Artikel] Fingersatz, in: ders., Musiklexikon [1. Aufl.],
Berlin: Max Hesses Verlag, 1935, S.221–222; hier S. 222.
[5c] Kurt Schubert, Die Technik des Klavierspiels aus dem Geiste des musikalischen Kunstwerkes, 3. Aufl., Berlin: Walter de Gruyter, 1954 (Reihe: Sammlung Göschen, Bd. 1045), S. 70.
[5d] Hans Joachim Moser, [Artikel] Liniensystem, in: ders., Musiklexikon, Dritte,
völlig umgearbeitete Aufl., Hamburg: Musikverlag Hans Sikorski, 1951, S. 636 f.; hier
S. 637. Moser gibt hier auch drei Beispiele, wie die Notenlinien mit Tönen zu belegen bzw. mit unterschiedlichen Abständen zu versehen wären, um die zwölf Halbtöne
korrekt zu repräsentieren.
[5e] Ein weiterer Irrtum, dessen Opfer ich wurde, sei im Folgenden kurz beschrieben.
Wie sehr ich als Spieler von einer Tastatur und deren Begrenzungen auf der linken und
rechten Seite nämlich abhängig bin, wurde mir erst bewusst, als ich ständig auf einem
„Bösendorfer Imperial“ musizierte, der bekanntlich im tiefsten Bass über neun Tasten mehr als andere Flügel verfügt und solchermaßen vom tiefsten bis zum höchsten Ton
acht ganze Oktaven besitzt. Dieser um etwa 12 cm größere Umfang der Tastatur, der dem Instrument insgesamt auch größere Abmessungen verleiht, bereitete mir zunächst
immer wieder Schwierigkeiten, sobald Basstöne in einer Komposition gleichsam blind oder mit sehr kurzer Möglichkeit der optischen Orientierung anzuschlagen waren, und
ich vergriff mich öfters im Bass, wo das Spielfeld erweitert war. Aus meiner Schwierigkeit, die sich durch regelmäßiges Spiel auf diesem Flügel-Modell beheben
ließ, erkannte ich jedoch die Bedeutung, welche den Begrenzungen einer Tastatur zukommt. Eine durchgängig schwarze Färbung dieser zusätzlichen Tasten oder eine
Klappe darüber (die Tasten werden nur ausnahmsweise wie andere angeschlagen), lösten das Problem nur zum Teil, da man sich als Spieler auch daran orientiert, wie das
Instrument als Ganzes begrenzt ist und wo die Tastatur aufhört. Solches kommt jedoch nur dann zur Geltung, wenn man das Konventionelle als „Natürliches“ empfindet, was
besonders dann eintritt, sobald man sich den Gegebenheiten eines solchen erweiterten Instruments unerwartet gegenübersieht und mit dessen Eigenheiten nicht vertraut ist.
[6] Vgl. Josef Matthias Hauer, Zwölftontechnik. Die Lehre von den Tropen (ders., Theoretische Schriften, Bd. II), Wien, New York: Universal-Edition A.G., [1926],
Seite 3. (Kursives im Original gesperrt.) – Vgl. hierzu auch Wilhelm Keller, Integralnotation. Zur Diskussion um eine Notenschriftreform, in: Zeitschrift für
Musik, 116. Jg., Heft 8/9, Regensburg 1955, S. 476–481; hier zu Hauers Notation S. 479 f. – Dass Busonis Notationsmodell von Schönbergs Klavierstücken op. 11
angeregt wurde, erwähnt Rudolf Stephan in seinem Aufsatz Über Josef Matthias Hauer, in: Archiv für Musikwissenschaft, hg. von Wilibald Gurlitt, 18. Jg., H. 3/4,
Trossingen 1961, S. (265)–293; hier in der Fußnote auf S. 266.
[7] Vgl. Ferruccio Busoni, Versuch einer organischen Clavier-Noten-Schrift,
faksimilierter Abdruck des handschriftlichen Entwurfs, in: Reinhard Ermen, Ferruccio Busoni, Reinbek: Rowohlt, August 1996, (= Rowohlt Monographie [Bd.] 483); hier
S. (80)–(81). Publikation: Leipzig 1910.
[8] Vgl. Johannes Wolf, Handbuch der Notationskunde, II. Teil: Tonschriften der Neuzeit, Leipzig 1919, Reprint: Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1963,
S. 358–359.
[8a] Vgl. dazu Othmar Steinbauer, Lehrbuch der Klangreihen-Komposition. Melos und Sinfonie der zwölf Töne, Als Manuskript herausgegeben vom Seminar für
Klangreihenkomposition in Wien, vervielfältigtes Typoskript, 114 Blätter sowie
Anlagen; Vorwort datiert (Blatt 5): „Wien, im Herbst 1960“. Hier Blatt 64–69: Die Zwölfton-Notenschrift. Hinweis von Johann Sengstschmid, St. Pölten. Hierzu die
Website Johann Sengstschmid, Panchromatische Überlegungen.
[8b] Das Verfahren, jede Note mit einem Vorzeichen zu bedenken (unmittelbar
repetierte Noten werden ausgenommen), wurde zu einer Art Merkmal, ja einem Markenzeichen der Dodekaphonie, dem man beispielsweise auch in den frühen
Klavierwerken von Boulez oder Stockhausen begegnet. Selbst die erste Note des Klavierstücks I von Stockhausen, die eine Untertaste bezeichnet, erhält dort ein
Auflösungszeichen, das sich, da es genau genommen nichts aufzulösen gibt, nur aus dieser von Schönberg kommenden Tradition erklären lässt. Sichtbar wird hier
der Versuch, sich der Schwerkraft der im Notenbild fortlebenden Diatonik zu erwehren und auch optisch durch eine grundsätzliche Bezeichung aller Noten ihre
Gleichrangigkeit zu repräsentieren.
Bei dieser Gelegenheit sei das Folgende angesprochen: Das Nichtzählen, also
das Ausklammern wiederholter Töne, das im Rahmen der Zwölftontechnik zu beobachten ist, widerspricht meines Erachtens der Absicht, nicht einen der Töne
hervortreten zu lassen und die Wiederholung einer Tonhöhe grundsätzlich erst dann zu erlauben, sobald alle elf anderen Töne in Erscheinung getreten waren. Die
Wiederholung von Tönen schafft genau jene Schwerpunkte erneut, die es gemäß den Regeln der Zwölftontechnik gerade zu vermeiden galt, und man kann sich
in Schönbergs Präludium seiner Suite op. 25 (1921–1923) davon eine Vorstellung
machen, wo mehrfach repetierte Töne auftreten (etwa in T. 3–5). Die Repetition muss
freilich nicht auf einen einzigen Ton beschränkt sein, sondern kann ebenso zu einer wiederholten Figur gehören, wie beispielsweise am Anfang (später noch mehrfach) des Intermezzo in derselben Suite.
[9] Vgl. hierzu „A Letter from Mr. John Freke F. R. S. [Fellow of the Royal Society] Surgeon to St. Bartholomew’s Hospital, to the President of the Royal Society,
inclosing a Paper of the late Rev. Mr. Creed, concerning a Machine to write down Extempore Voluntaries, or other Pieces of Music“, in: Philosophical Transactions,
No. 483 (for the months March, April, and May), Vol. XLIV, P[art] II, London 1747, S. 445–450. Die Zeitschrift ist im Internet zugänglich auf den Webseiten von Gallica. – Freke wird nach Gerbers Lexikon „Freake“ buchstabiert. Er starb nach demselben
Lexikon bereits 1717, vgl. den Artikel Freake (Iohn) in: Ernst Ludwig Gerber, Neues historisch=biographisches Lexikon der Tonkünstler […], Zweyter Theil E–I,
Leipzig: A. Kühnel, 1812, Spalte 188 (pdf, S. 105/435). Der Artikel Gerbers geht vornehmlich auf Freakes genannten und nur scheinbar postum veröffentlichten Beitrag in den Philosophical Transactions von 1747 ein. (Creed ist in Band I des Lexikons
nicht mit einem eigenen Artikel behandelt.) Vermutlich verwechselte Gerber aber den
gleichnamigen Vater, der ebenfalls „surgeon“ war und 1717 verstarb, mit dem Sohn John Freke (1688–1756). Download des Gerber-Lexikons hier.
[9/9a] Verwiesen sei auch auf den Baudot-Code (Fernschreib-Code), dessen Gerät
zur Herstellung des codierten Texts ebenfalls über fünf Tasten verfügte (1870). Diese Anlage war offenbar von den fünf Obertasten eines Klaviers beeinflusst, denn hier hatte
man es nur mit 2 + 3 Tasten zu tun, so dass man das Gerät auch Clavier Baudot nannte. (Abbildung und zugehöriger Artikel).
[9a] Die A-Moll-Fassung findet man als Grande Fantaisie de Bravoure sur la
Clochette de Paganini (op. 2) von 1834; die Noten stehen in der am Ende dieser Anmerkung genannten Ausgabe als Abteilung II, Bd. II (Revision: Ferruccio Busoni,
datiert: September 1911), S. 2 (100)–S. 31 (129), Online-Ausgabe.
Die As-Moll-Fassung steht in derselben Ausgabe als Nr. 3, Campanella, in Liszts Etudes d’Exécution transcendante d’après Paganini von 1838; Noten in Abt. II,
Bd. III, S. 22–29, Online-Ausgabe.
Schließlich das Werk im großen (endgültigen) Format: La Campanella in Gis-Moll als Nr. 3 der Grandes Etudes de Paganini (zweite Ausgabe, komponiert 1838,
Umarbeitung 1851), Noten in Abt. II, Bd. III, S. 17 (77)–S. 25 (85), Online-Ausgabe.
Zitiert wird nach folgender Ausgabe: Franz Liszt, Musikalische Werke, hg. von
der „Franz Liszt-Stiftung“, Leipzig: Breitkopf & Härtel, verschiedene Herausgeber und
Jahrgänge [beginnend ca. 1910 ff.], digitalisiert von der Bayerischen Staatsbibliothek München siehe unter http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.
html?projekt=1193812455 (in der Internet-Übersicht sind die lateinischen Ziffern
durch arabische ersetzt: Bd. 2,3 = Abt. II, Bd. III). Es handelt sich hierbei um die sogenannte „Carl-Alexander-Ausgabe“.
Darauf hingewiesen sei, dass es sich bei den drei Fassungen von Liszts Campanella
(A-Moll, As-Moll und Gis-Moll) jeweils um eigenständige Kompositionen, nicht um bloße Transpositionen handelt. Diese Fassungen haben zwar als gemeinsamen
Mittelpunkt Niccolo Paganinis „Glöckchen“-Thema (Variationen), sind darüber hinaus jedoch weitgehend unabhängig.
[9b] Ausgabe wie unter [9a] (vierter Absatz), Abt. II, Bd. XII: Ungarische
Rhapsodien für Pianoforte zu zwei Händen, Revision: Peter Raabe; Datierung der Ausgabe auf S. XV: im Frühjahr 1926, S. 1 (17)–S. 16 (32), Online-Ausgabe.
Hier eine Seite S. 7 (23) mit den Cis-Repetitionen (Online-Ausgabe).
[9c] Ausgabe wie unter [9a], Abt. II, Bd. III: Etüden für Pianoforte zu zwei Händen
(wie oben), Franz Liszt, Drei Konzert-Etüden (komponiert 1848), S. 2 (114) bis S. 27 (139); hier Nr. 3 auf S. 19 (131) ff. (Online-Ausgabe).
[9d] Online-Ausgabe, Abt. II, Bd. II (wie Anm. [9a]), Vorwort datiert: „Berlin, im
September 1911 Ferruccio Busoni“; hier S. 43, vorletzter Takt. (Liszt stimmt auf
dieses Ende 4 und 6 Takte zuvor ein.)
[9e] Auf der viertletzten Seite (S. 15 von 18) schreibt Balakirew vor dem einzigen
Glissando des Stückes eine Transposition der Obertasten (b-as-ges-es-des-b- usw.) auf die Untertasten (a-g-f-d-c-a- usw.) in beidhändigen um ein Sechzehntel versetzten
Doppeloktaven (vgl. Anm. [9d]), ein Verfahren, das sowohl Chopin wie Liszt (mutatis mutandis) anwandten. Siehe auch oben.
[9f] Letters of Franz Liszt,Vol. I, New York, N.Y. 10012: Haskell House Publishers
Ltd., 1894 [London: H. Grevel 1894], Textausgabe [Link veraltet, 20.2.2019] im „Project Gutenberg“; bei „Google Books“ als Brief Nr. 5, S. 7–10, hier Zitat auf S. 8.
[9g] Maurice Ravel, Miroirs (Piano), London: Schott & Co., Ltd. (Copyright by
E. Demets 1906); vgl. die Repetitionen auf S. 34–35 oder S. 41–42. – Ähnliches ist in Ravels Scarbo aus seinem Gaspard de la nuit (1908) oder in Balakirews Islamej zu
beobachten.
[9h] Es handelte sich um folgende Veranstaltung: „BENCE PETER breaking the GUINNESS WORLD RECORD of the ,most piano key hits in one minute‘“ (Video-
und Audio-Aufnahmen in Debrecin, Ungarn, am 15. Januar 2012 im Kolscey Convention Center). Soweit ich die Ansage der Moderation verstand, brach Bence
den Rekord, indem er 765 Anschläge pro Minute ausführte und damit den bisherigen Rekord von 669 Anschlägen aus dem Jahre 2011 (Sai Manapragada, USA) um fast
100 Anschläge übertraf. Auch die Kamera, welche die Tasten durch die Hände von Manapragada live filmen musste, liess beim eigentlichen Test unklar, ob der Pianist eine
Ober- oder Untertaste verwendete. Die Tonhöhe, die mir jedoch dieselbe wie bei Bence Peter zu sein schien, ist jedenfalls kein sicherer Beweis und allenfalls ein
Hinweis, da sich diese Saiten leicht umstimmen lassen und die Spannung der Saiten auch eine Rolle für ihre Fähigkeit, sauber zu repetieren, spielen mag.
[10] Paul von Janko erfand 1882 die nach ihm benannte „Janko-Klaviatur“, in der drei
Reihen von Ober- und Untertasten, also insgesamt sechs Tastenreihen, terrassenförmig angelegt sind. Auch der Wiener „Chroma-Verein des Gleichstufigen Tonsystems“
(1875–1877) setzte sich für eine chromatische Klaviatur ein. Vgl. N. Meeùs, a. a. O. (s. Anm. 3), S. 383: 3. Experimental Keyboards (mit Abbildung der Janko-Tastatur);
Klaus-Georg Pohl, Die Jankó-Klaviatur, Hausarbeit für die Zulassung zur staatlichen Musiklehrerprüfung, Musikhochschule des Rheinlandes, Grenzlandinstitut Aachen, o. J.
(Datierung der Bibliothek: 21.1.[19]88), 74 S. sowie Friedrich Wilhelm Riedel, [Artikel] Klavier (= Sp. 1090–1101), in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
Bd. 7, © 1958, Reprint 1989, Sp. 1095. Vgl. auch Hans Heinz Draeger, [Artikel] Janko, Paul von, ebd., Bd. 6, © 1957, Reprint 1989, Sp. 1709–1713. Hier auch das
Photo eines Pianinos mit Janko- und Normalklaviatur (Sp. 1711).
[10a] Zu Vincent vgl. Alfred Einstein (Bearb.), Hugo Riemanns Musiklexikon,
11. Auflage, Berlin: Max Hesses Verlag, 1929, Bd. 2, S. 1944 den Artikel Vincent (eigentlich Winzenhörlein), Heinrich Joseph; ferner Paul Frank/Wilhelm Altmann, Kurzgefaßtes Tonkünstler-Lexikon, Erster Teil: Neudruck der Ausgabe von 1936,
15. Aufl., Wilhelmshaven: Heinrichhofen’s Verlag, © 1971, S. 653; ferner Deutsche Biographische Enzyklopädie, hg. von Walther Killy und Rudolf Vierhaus, Bd. 10,
München: Saur, 1999, S. 211. Bei dem erwähnten Druck handelt es sich um Heinrich Josef Vincent, Die Neuklaviatur. Ihre Vortheile gegenüber den Nachtheilen der
alten. Ein Aufruf zur Beherzigung an alle Musiker und Dilettanten, Klavier-Lehrer und Fabrikanten, Malchin: Adolph Hothan, Buch- und Musikalienhandlung,
1875 (vorhanden in der Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel); pdf-download unter der URL http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/download2.html?litID=lit38212&pn=2. – Eine Übersicht über die Problematik, die zeigt, dass sich viele Generationen mit ihr befassten, stammt von M[elchior] E[rnst] Sachs (1843–1917
) und trägt den Titel: Vortrag über den Nutzen der Einführung einer auf die Gleichberechtigung der zwölf Töne unseres temperirten Tonsystems gegründeten
Theorie, Schrift und Tastenordnung, gehalten bei der allgemeinen deutschen Lehrerversammlung zu Darmstadt, Pfingsten 1885 von M. E. Sachs, k[öniglicher]
Professor in München, München: Gedruckt bei J. Gotteswinter, 1885; pdf-Download hier (URL der Staatsbibliothek München, Signatur: Mus. th. 2872).
[10b] Vgl. dazu Martin Vogel, Schönberg und die Folgen. Die Irrwege der Neuen Musik, Teil 1: Schönberg, Bonn: Verlag für systematische Musikwissenschaft GmbH,
1984 (Orpheus-Schriftenreihe zu Grundfragen der Musik, hg. von Martin Vogel,
Bd. 35); hier besonders S. 126 f. und 297 f. – Mit Recht verweist Vogel auf Vincents Die Zwölfzahl in der Tonwelt, in: Musik-Instrumenten-Zeitung. Fach- und
Anzeigenblatt für Fabrikation, Handel u. Export von Musik-Instrumenten aller Art, Jg. 1892–1893, No. 52, Berlin, 23. September 1893, Seite 982 f.; mit einem
Brief von Vincent (Wien, 23.8.1893).
[10c] Karl Bernhard Schumann, Vorschläge zu einer gründlichen Reform in der
Musik durch Einführung eines höchst einfachen und naturgemässen Ton- und Notensystems nebst Beschreibung einer nach diesem System construirten Tastatur für das Fortepiano, Berlin: Verlag der Gsellius’schen Buchhandlung, 1859,
(25) Seiten (pdf); zum Teil zitiert nach Dittrich-Kalkhoff (wie Anm. [10d], Seite 151). Download von der Webseite der Eastman School of Music (Rochester).
[10d] Franz Diettrich-Kalkhoff, Geschichte der Notenschrift, mit 3 Abbildungen, 18
Tabellen und zahlreichen Notenbeispielen im Text, Jauer in Schlesien: Verlag von Oskar Hellmann, 1907 (vorhanden in der SUB Göttingen, worin auch die Tafeln sind).
– Die Abbildung, die hier reproduziert ist, befindet sich auf S. 11 in dem Druck von 1859 (vgl. Anm. 10c).
[10e] Heinrich Josef Vincent zitiert in seiner Schrift Neuklaviatur aus einem Brief
von G. Hüllmann, dem Leiter der bedeutenden Königsberger Klavierbaufirma Carl Julius Gebauhr (1809–1881), dass dieser „den schmalen Ausläufer des C roth gefärbt,
und das G (Quinte, Tonart mit #) weiss gemacht“ hat (wie Anm. 10a, S. 36). Hüllmann
hatte bei dem Erscheinen von Vincents Schrift bereits eine Neuklaviatur anfertigen lassen und in der Praxis erprobt (ebd., S. [5]).
[11] Vgl. hierzu F. W. Riedel (siehe Anm. 10), Sp. 1095.
[11a] Zu Vincents Diskussion eines vier- bzw. sechszeiligen Notensystems siehe das Kapitel Unsere Notation (Anm. 10a, S. 18 f.). Analog zur „Neuklaviatur“ wird der „Neuschlüssel“ propagiert.
[12] Vgl. H. J. Moser (siehe Anm. 2), Sp. 403–409; hier zur neunzehntönigen
chromatischen Skala Sp. 405 unten.
Fortsetzung Teil 2
Entstanden: Grundfassung 6. Juli 1994 bis November 1997; zahlreiche Ergänzungen
Erste Eingabe ins Internet: Donnerstag, 25. Oktober 2001
Letzte Änderung: Mittwoch, 20. Februar 2019
© 2001–2019 by Herbert Henck
|

